Anläßlich der Informationsveranstaltung der Gemeinde Pronstorf am 03.07. um 19.00 in der Strengliner Mühle zum Repowerig der Windkraftanlagen im Windpark Obernwohlde auf eine Höhe von 261 m möchten wir noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen.
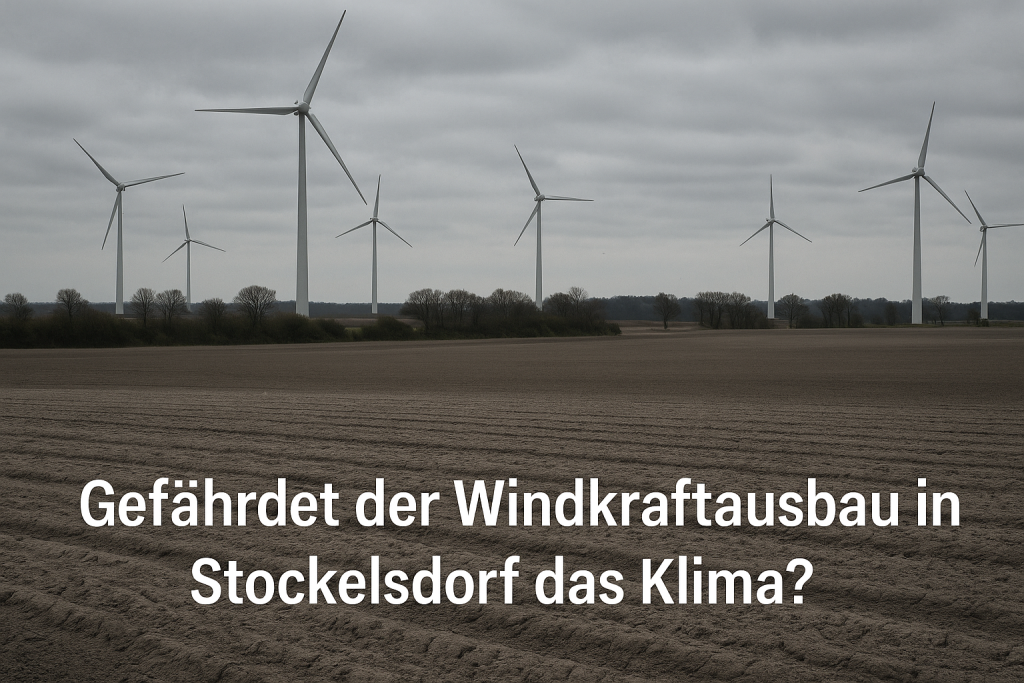 Klimarisiken durch Windkraftanlagen
Klimarisiken durch Windkraftanlagen
Windenergie gilt als Hoffnungsträger der Energiewende – klimafreundlich, emissionsfrei, nachhaltig. Doch ein näherer Blick auf die physikalischen Zusammenhänge und die inzwischen messbaren regionalen Wetterveränderungen durch Windparks wirft ernsthafte Fragen auf. Wächst hier ein Problem heran, das wir bislang ausblenden?
Windräder und ihr Einfluss auf das regionale Klima
Windkraftanlagen entziehen der Atmosphäre kinetische Energie, um Strom zu erzeugen. Was simpel klingt, hat physikalisch weitreichende Folgen: Hinter jeder Turbine entsteht ein sogenannter Nachlauf – eine Zone mit verlangsamtem, turbulenten Wind, der sich über viele Kilometer erstrecken kann. Diese Windverlangsamung stört die natürlichen Luftströmungen und damit auch den Transport von Feuchtigkeit und Regenwolken.
Physiker wie Dr. Michael Dost und Dr. Peter Adel weisen darauf hin, dass der großflächige Ausbau von Windkraft in Deutschland bereits zu einer Beeinträchtigung der wetter- und klimarelevanten Transportfunktion des Windes führt. In der Konsequenz: weniger Regen im Inland, verlängerte Trockenphasen und eine Zunahme von Extremwetterereignissen wie Starkregen und Dürren.
Belegbare Veränderungen: Erwärmung und Bodenfeuchtigkeitsverluste
Studien belegen: In Regionen mit hoher Windkraftdichte lässt sich ein messbarer Anstieg der Bodentemperatur und ein Rückgang der Bodenfeuchtigkeit beobachten. Eine Untersuchung an der Universität Wageningen (NL) zeigte, dass Windparks der Atmosphäre Feuchtigkeit entziehen – insbesondere im Sommer. In einem Zeitraum von fünf Jahren wurde ein lokaler Temperaturanstieg von 0,27 °C gemessen.
Ein weiteres Beispiel liefert das Jahr 2021: In der Region südlich von Paderborn, dicht mit Windrädern bestückt, wurde ein Niederschlagsverlust von über 300 Litern pro Quadratmeter festgestellt. Solche Defizite sind für die Trinkwasserversorgung, etwa über Talsperren, von kritischer Bedeutung.
Theoretische Grenzen: Die Physik gibt vor, was möglich ist
Laut einer Analyse von Dr. Dost liegt das technisch nutzbare Windenergiepotenzial in Deutschland bei maximal 25 GW mittlerer Leistung – bei einer Gesamtstromnachfrage von über 3.600 TWh jährlich entspricht das einem Anteil von unter 10 %. Jeglicher Versuch, dieses Potenzial zu überschreiten, würde unweigerlich mit einem massiven Eingriff in das Klima- und Wettersystem einhergehen.
Kritik an blinder Ausbaupolitik
Während Bundesministerien den Ausbau der Windenergie weiter vorantreiben, wird in offiziellen Verlautbarungen kaum auf diese Probleme eingegangen. Vielmehr ist von der „Vereinbarkeit mit dem Artenschutz“ oder „Beseitigung bürokratischer Hürden“ die Rede. Die möglichen klimatischen Schäden, auf die internationale Studien wie „Climate Impacts of Wind Power“ (Keith & Miller, Harvard University, 2018) bereits hinweisen, werden weitgehend ignoriert.
Fazit: Notwendige Debatte statt Ausbau um jeden Preis
Die Energiewende darf nicht zur Klimabelastung werden. Windkraft ist nicht per se schlecht – doch ihre großflächige Nutzung muss kritisch, faktenbasiert und ergebnisoffen bewertet werden. Es braucht dringend unabhängige Forschung zu den klimatischen Folgen von Windparks sowie eine ehrliche Diskussion darüber, ob und wo ihr Einsatz ökologisch wirklich sinnvoll ist.
